Kooperation oder Neokolonialismus?
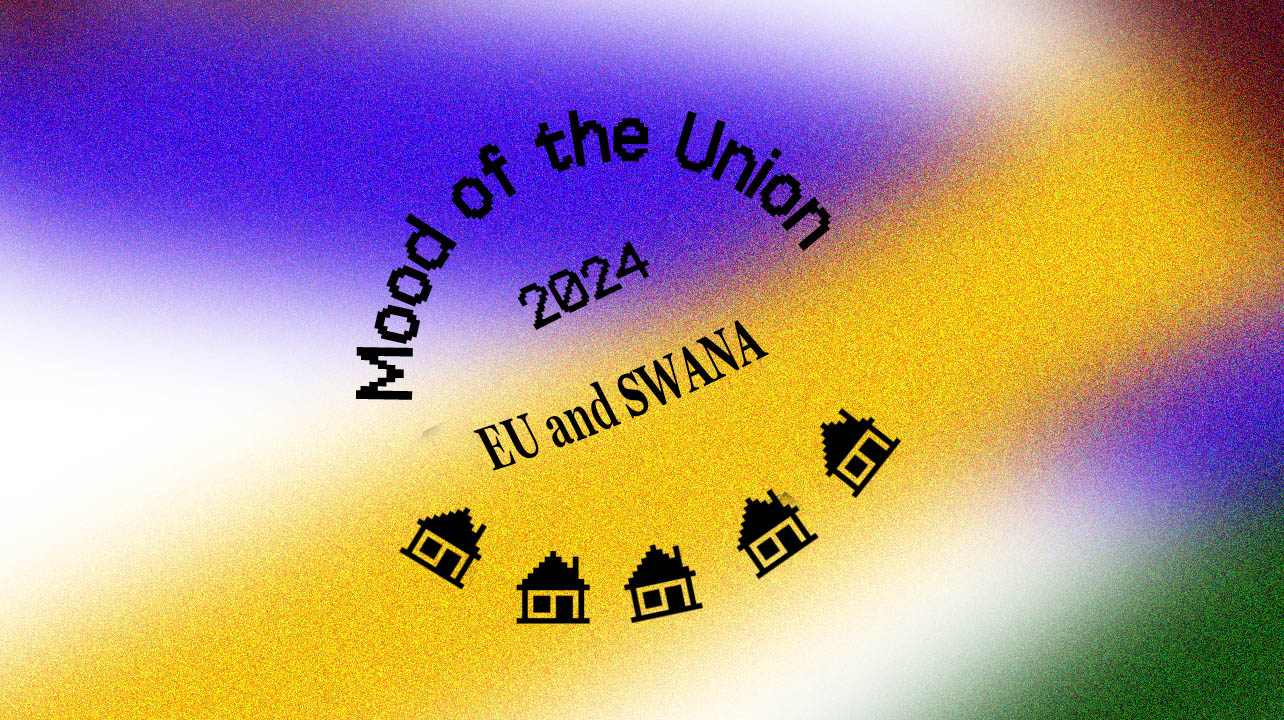
In den letzten Jahren hat die Europäische Union (EU) ihre Position als globaler Akteur gefestigt angespornt durch akute Herausforderungen wie die COVID-19-Pandemie und den anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Diese Krisen haben zu einer Neubewertung der Außenpolitik der EU geführt. Dabei hat sich die Unterscheidung zwischen nationaler und internationaler Politik verwischt, was zeigt, wie nationale Wahlen und Politiken weitreichende Auswirkungen auf die globale Dynamik haben können.
Ein zentraler Bereich der Verflechtung ist der Umgang der EU mit der Migration, die für ihre Außenpolitik von zentraler Bedeutung ist, insbesondere seit der Flüchtlingskrise von 2015. Über 2,39 Millionen Migranten haben seitdem das Mittelmeer nach Europa überquert, was zu einer intensiven politischen Fokussierung auf die Bewältigung der Migration führte, die oft als „Management“ bezeichnet wird und hauptsächlich die südlichen Nicht-EU- und EU-Mittelmeerstaaten betrifft.
Der Diskurs über Migration hat stark zugenommen, und eine Umfrage des Europäischen Rates für Auswärtige Beziehungen vom Januar 2024 zeigt, dass Einwanderung in der EU ein wichtiges Thema ist. Die extreme Rechte hat aus diesem Thema Kapital geschlagen und die etablierten Parteien in ganz Europa dazu veranlasst, ihre Positionen zur Einwanderung zu ändern um dem entgegenzuwirken, was zu einer ernsthaften Wahlherausforderung geworden ist.
Dieser Wandel hat sich auf EU-Ebene niedergeschlagen. Der Block hat zunehmend eine transaktionale Außenpolitik Strategie angenommen, die sich um Externalisierungsabkommen dreht und in erster Linie auf Nicht-EU-Mittelmeerländer abzielt, die sowohl als Herkunfts- als auch als Transitländer für Migranten wichtig sind, darunter die Türkei, Ägypten, Tunesien und der Libanon. Diese oft als Cash-for-Control -Deals bezeichneten Abkommen motivieren die Länder finanziell dazu, die Migration an den Grenzen der EU zu steuern.
Neben der Migration baut die EU auch ihre Zusammenarbeit mit diesen Nicht-EU-Partnern in Bereichen wie Handel, Energiesicherheit und Dekarbonisierung aus. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schmiedet vor dem Ende ihrer Amtszeit aktiv neue Partnerschaften mit dem Ziel, die Beziehungen zu vertiefen. Diese Bemühungen werfen jedoch Fragen zu den zugrundeliegenden politischen Motiven und zur Ausgewogenheit der Vorteile zwischen der EU und ihren Nicht-EU-Partnern im Mittelmeerraum auf. Es gibt auch Bedenken, dass diese Abkommen repressive Regime unterstützen könnten, indem sie ihnen zusätzliche Legitimität und Wirtschaftshilfe verschaffen, die zur weiteren Festigung ihrer Macht genutzt werden.
Syrien
Der Krieg in Syrien war in den letzten zehn Jahren ein wichtiger Schwerpunkt der Außenpolitik der EU. Der Krieg brach 2011 aus, nachdem die Regierung friedliche Pro-Demokratie-Proteste unterdrückt, mehr als eine halbe Million Menschen getötet und etwa die Hälfte der Bevölkerung vertrieben hatte. Mehr als ein Jahrzehnt später, nachdem ein Großteil des Gebiets von den syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung russischer und iranischer Verbündeter zurückerobert wurde, dauert der Konflikt an, ohne dass ein Ende in Sicht wäre.
ein Ende in Sicht.Die Weigerung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, mit den Widerstandsgruppen zu verhandeln, sowie die Beteiligung des Regimes an illegalen Aktivitäten wie dem Drogenhandel, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, erschweren die Aussicht auf Frieden zusätzlich.Friedensbemühungen unter der Führung der Vereinten Nationen, einschließlich des Versuchs, eine neue Verfassung auszuarbeiten, haben keine Wirkung gezeigt. Die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga und die allmähliche Wiederherstellung der regionalen Beziehungen machen die Aussicht auf eine Beendigung des Konflikts zu Bedingungen, die nicht von Assad diktiert werden, zunehmend unwahrscheinlich.
Die Syrien-Politik der EU orientiert sich auch heute noch an der im April 2017 vom Rat verabschiedeten Strategie zu Syrien. Politisch unterstreicht diese Strategiedie Haltung der EU gegen eine Normalisierung der Beziehungen zum syrischen Regime und ihr Engagement für die Aufrechterhaltung der Sanktionen. Im Bereich der humanitären Hilfe unterstreicht sie das anhaltende Engagement der EU in Syrien. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind weiterhin der größte Geber für Syrien und haben seit Beginn des Krieges mehr als 30 Milliarden Euro an humanitärer und wirtschaftlicher Hilfe bereitgestellt.
Die von der EU verhängten Sanktionen richten sich gegen Personen und Einrichtungen, die mit illegalen Aktivitäten und der gewaltsamen Unterdrückung des syrischen Volkes in Verbindung stehen. Die Sanktionen, die darauf abzielen, die finanziellen Ressourcen des Regimes zu beschneiden und Assad zu politischen Reformen zu zwingen, haben bisher noch nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, und ihre Wirksamkeit und ihre Auswirkungen auf die syrische Bevölkerung sind nach wie vor Gegenstand von Diskussionen innerhalb der EU. Trotz der Sanktionen ist die EU Syriens größter Handelspartner.
Seit Beginn desKrieges im Jahr 2011 wurden mehr als 14 Millionen Syrerinnen und Syrer vertrieben, mehr als 7,2 Millionen sind derzeit Binnenflüchtlinge. Benachbarte Länder wie die Türkei, der Libanon, Jordanien, der Irak und Ägypten beherbergen zusammen etwa 5,5 Millionen syrische Flüchtlinge, wobei Deutschland mit über 850.000 das größte EU-Zielland ist.
Im dreizehnten Jahr seines Bestehens wurde der Krieg in Syrien verschlimmert durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch, den Verlust von Lebensgrundlagen, anhaltende Dürres, und das verheerende Erdbeben 2023 Erdbeben, das die humanitäre Krise auf ein noch nie dagewesenes Ausmaß anschwellen ließ. Von den 18 Millionen Menschen in Syrien sind 16,7 Millionen bedürftig auf humanitäre Hilfe angewiesen; wenn man die Diaspora mit einbezieht, liegt die Zahl über 30 Millionen. Gegenwärtig leben mehr als 80 % der Syrer unter der internationalen Armutsgrenze eine deutliche Steigerung gegenüber den 10 % vor Beginn des Konflikts. Im Jahr 2024, significant cuts in funding by the World Food Programme have a 80% decrease in the number of Syrians receiving food assistance, severely affecting child nutrition and worsening the situation yet further.
Trotz der anhaltenden humanitären Situation haben mehrere Länder, die syrische Flüchtlinge und Asylbewerber aufnehmen – darunter der Libanon, Dänemark und die Türkei -, versucht, diese nach Syrien zurückzuschicken. Dies ist ein politischer Schachzug, der von zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr kritisch gesehen wird. In einem Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte vom Februar 2024OHCHR wurde das Leiden der Rückkehrer hervorgehoben, deren Situation „ernste Fragen hinsichtlich der Verpflichtung der Staaten zu einem ordnungsgemäßen Verfahren und zur Nichtzurückweisung aufwirft“, wie es der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk ausdrückte.
Angesichts der zahlreichen Herausforderungen in den Aufnahmeländern sind Hunderttausende syrische Kriegsflüchtlinge trotz der düsteren Sicherheits- und humanitären Lage in ihre Heimat zurückgekehrt.
.Türkei
Durch die gleichen verheerenden Erdbeben im Jahr 2023 hat die Türkei eine jahrzehntelange Rezession durchgemacht. Die offizielle Inflation hat fast 60% erreicht, womit das Land nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) an fünfter Stelle in der Welt steht. Als die türkische Lira gegenüber dem Euro und dem Dollar abstürzte, rechneten Kritiker von Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einem Regierungswechsel bei den im Mai 2023 stattfindenden Präsidentschaftswahlen . Doch Erdogan sicherte sich eine weitere fünfjährige Amtszeit und setzt damit seine zwei Jahrzehnte währende Herrschaft fort.
Die Kommunalwahlen 2024 zeichneten jedoch ein anderes Bild: Die größte Oppositionspartei, die Republikanische Volkspartei (CHP), erzielte deutliche Siege in Großstädten wie Istanbul, Ankara und Izmir und eroberte traditionell starke AKP-Städte am Schwarzen Meer und in Anatolien. Die Ergebnisse haben bei den Anhängern der Opposition, die nach jahrelangen Niederlagen demoralisiert waren, neue Hoffnung und Motivation geweckt.
Jahre lang.Diese Entwicklung versetzte Erdogans Ambitionen einen schweren Schlag, zumal er gehofft hatte, weniger als ein Jahr nach seiner dritten Amtszeit als Präsident die Kontrolle über die Städte zurückzuerlangen. Daraufhin schwor er, die Hauptprobleme, die zur Wahlniederlage seiner Partei geführt hatten, insbesondere die steigende Inflation, zu beseitigen. In einer Geste der Versöhnung führte Erdogan zum ersten Mal seit fast acht Jahren Gespräche mit dem Vorsitzenden der CHP.
und signalisierte damit eine mögliche Veränderung der politischen Landschaft der Türkei.Erdogans Amtszeit hat dramatische Veränderungen in den Beziehungen der Türkei zur EU mit sich gebracht. Zunächst machte das Land Fortschritte auf dem Weg zur EU-Kandidatur, setzte wichtige Reformen um und erlebte ein Wirtschaftswachstum, das das Land zu einem geschätzten Partner machte. Im zweiten Jahrzehnt seines Wirkens vollzog Erdogan jedoch eine Hinwendung zu östlichen Bündnissen und eine Zunahme der Anti-EU-Stimmung, um seine Popularität im eigenen Land zu steigern. Der jüngste Fortschrittsbericht der EU, der EU nannte als Hindernisse für den Fortschritt, dass die Türkei die Rechtsstaatlichkeit, die demokratischen Werte und die Menschenrechte nicht einhält, sowie den ungelösten Streit mit den griechischen und türkischen Zyprioten. Trotz Erdogans Versuchen den EU-Prozess der Türkei mit anderen geopolitischen Fragen zu verknüpfen, wie z.B. der NATO-Mitgliedschaft Schwedens, sind innerhalb der EU die Rufe nach einem Abbruch der Beitrittsgespräche lauter geworden, auch von Ländern wie Österreich.
Allerdings haben umfassendere geopolitische, wirtschaftliche und ökologische Veränderungen zu einer Vertiefung der Handelsbeziehungen zwischen der Türkei und der EU geführt. Türkiye ist aktiv zur Verbesserung seiner Handelslogistik mit der EU, arbeitet an der Abschaffung von Transitquoten und der Straffung der Zollverfahren, um die Handelskosten zu senken und die Exporte zu steigern. Diese laufenden Verhandlungen zielen auch darauf ab, die hohen Kosten und restriktiven Visabestimmungen für türkische Transportfahrer in der EU zu verringern. Darüber hinaus verändert der Green Deal der EU, der Klimaneutralität bis 2050 zum Ziel hat, die Handelspolitik und wirkt sich auf Nicht-EU-Partner wie die Türkei aus. Die Einführung von Maßnahmen wie dem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) drängt Türkiye, seine Dekarbonisierungsinitiativen zu beschleunigen.
Der Krieg in der Ukraine hat sich auch auf die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU ausgewirkt. Türkiye hat versucht eine neutrale Haltung einzunehmen, wobei Erdogan das Engagement der Türkiye für die territoriale Integrität der Ukraine hervorhob, während er sich diplomatisch mit Russland auseinandersetzte. Sein Ziel ist es, die Türkei als potenziellen Vermittler zu positionieren, mit einem Vorschlag Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland zu führen.
Die Türkei spielte eine Schlüsselrolle bei der Schwarzmeer-Getreide-Initiative, einer mit den Vereinten Nationen ausgehandelten Vereinbarung, die Getreideexporte aus der Ukraine inmitten des anhaltenden Konflikts ermöglichte. Diese Vereinbarung erleichterte die Ausfuhr von Millionen Tonnen ukrainischen Getreides auf die Weltmärkte, die zuvor aufgrund des Krieges blockiert waren. Der anschließende Rückzug Russlands aus dem Abkommen verschärfte nicht nur die Spannungen, sondern erschwerte auch die Position der Türkei und belastete ihre Beziehungen zu den EU-Mitgliedstaaten. Die EU, die jeglichem Vorgehen, das als Untergrabung der ukrainischen Souveränität wahrgenommen wird, kritisch gegenübersteht, betrachtete die neutrale Haltung der Türkei mit Skepsis.
Trotz der angespannten Beziehungen zeichnet sich zwischen der Türkei und der EU ein Konsens über die Notwendigkeit ab, den Rahmen ihrer Zusammenarbeit neu zu definieren. Während die Beitrittsgespräche nach wie vor auf Eis liegen, wird die Zusammenarbeit in einem Bereich fortgesetzt: der Migration. Im März 2016 unterzeichneten die EU und die Türkei ein Abkommen mit dem die „irreguläre Migration“ nach Europa eingeschränkt werden soll. Obwohl die Türkei die weltweit größte Anzahl von Flüchtlingen aufnimmt, hat sie die größte Anzahl von Flüchtlingen, faced für die Zwangsumsiedlung syrischer Flüchtlinge in die von ihr kontrollierten Gebiete in Syrien kritisiert, wobei Abschiebungen zu einem umstrittenen Thema wurden, insbesondere während Wahlperioden. Im März 2024 berichtete Human Rights Watch dass „Während die Türkiye in der Vergangenheit behauptete, dass alle Rückführungen freiwillig seien, haben türkische Streitkräfte seit mindestens 2017 Tausende von syrischen Flüchtlingen festgenommen, inhaftiert und summarisch abgeschoben und sie oft dazu gezwungen, „freiwillige“ Rückkehrformulare zu unterschreiben und sie zu zwingen, nach Nordsyrien zu gehen.‘
Ägypten
Die politische Landschaft Ägyptens hat sich seit dem Arabischen Frühling dramatisch verändert, vor allem in Richtung Militarisierung unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der den demokratisch gewählten, aber zunehmend antisäkularen Mohamed Morsi über einen Militärputsch im Jahr 2013 ablöste. Bei den jüngsten Wahlen Ende 2023 wurde Sisi inmitten von Anschuldigungen der Wahlmanipulation wiedergewählt. Diese Umwälzungen gehen einher mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Herausforderungen
, wie einer rekordhohen Inflation im Jahr 2023, unrealistisch ehrgeizigen Infrastrukturprojekten und der Abwertung des ägyptischen Pfunds, die große Teile der Bevölkerung in wirtschaftliche Bedrängnis gebracht hat.In Anbetracht der ägyptischen Wirtschaftskrise und der anhaltenden regionalen Konflikte besuchten die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und mehrere Staats- und Regierungschefs der EU im März 2024 Kairo, um eine gemeinsame Erklärung für eine strategische Partnerschaft zwischen der EU und Ägypten zu unterzeichnen. Dieses Abkommen umfasst ein Hilfspaket in Höhe von 7,4 Milliarden Euro, mit dem die ägyptische Wirtschaft gestärkt und die Migration nach Europa gesteuert werden soll, sowie die Zusammenarbeit bei Initiativen für kohlenstoffarme Energien und beim Bildungs-, Kultur- und Jugendaustausch.
Die Partnerschaft zielt auch darauf ab, die Zusammenarbeit im Energiebereich zu verstärken, indem die EU ihre Gas- und anderen Energieimporte aus Ägypten erhöht, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Ägypten hat auch großesInteresse an einer verstärkten Zusammenarbeit mit der EU im Rahmen des Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzen (CBAM) gezeigt, um seinen grünen Übergang zu unterstützen und die Treibhausgasemissionen von Schwerindustrien wie Zement, Aluminium und Düngemitteln zu verringern.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Partnerschaft sind Maßnahmen zur „Steuerung der Migration“. Diese Zusammenarbeit hat Bedenken geweckt über die Behandlung von Migranten und Flüchtlingen, von denen es in Ägypten etwa 480.000 gibt. Das Fehlen eines rechtlichen Rahmens für das Asylrecht, die Abhängigkeit von einem überforderten UNHCR und die wachsende Feindseligkeit gegenüber afrikanischen Migranten südlich der Sahara haben zu einer zunehmend prekären Situation für Flüchtlinge geführt.
Der EU-Deal wurde kritisiert für die Verschärfung des Drucks auf Flüchtlinge, insbesondere auf jene aus dem Sudan, durch die Erhöhung des Risikos der Abschiebung und die Verstärkung der Grenzsicherheitsmaßnahmen. Organisationen wie der Niederländische Flüchtlingsrat haben Bedenken geäußert dass die EU-Mittel nicht unbedingt die Bedingungen für Flüchtlinge in Ägypten verbessern, was darauf hindeutet, dass der Schwerpunkt eher auf der Eindämmung der Migration als auf der Bekämpfung der Ursachen von Vertreibung und der Gewährleistung des Flüchtlingsschutzes liegt.
Die Partnerschaft ist auch deshalb in die Kritik geraten, weil sie ein Regime stärken könnte, das für seine Unterdrückung der bürgerlichen Freiheiten berüchtigt ist. Unter Sisis Herrschaft haben die Razzien gegen die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit zugenommen, insbesondere während der Präsidentschaftswahlen. Es wurden bedeutende Gesetzesänderungen vorgenommen, die die Rechtsprechung des Militärs auf das zivile Leben ausweiten. Das restriktive Vereinsgesetz 2019 und neue Verordnungen im Jahr 2024 unterstreichen diese Verschärfung, schränken die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen erheblich ein und verletzen die öffentlichen Freiheiten.
Bei internationalen Veranstaltungen wie der COP27 hat die internationale Gemeinschaft die Menschenrechtslage in Ägypten offen kritisiert. Während diese globalen Foren die ägyptische Regierung manchmal dazu gezwungen haben, auf die Kritik zu reagieren, bleiben wesentliche Verbesserungen aus, was Zweifel an Ägyptens Verpflichtungen gegenüber seinen internationalen Partnerschaften aufkommen lässt.
Tunesien
Tunesien, einst als Leuchtturm des Arabischen Frühlings gepriesen, steht vor unsicheren politischen Zeiten mit anstehenden Präsidentschaftswahlen, die für Ende 2024 angesetzt sind. Es wird erwartet, dass der amtierende Präsident Kais Saied erneut kandidiert. In seiner Amtszeit nach der umstrittenen Machtergreifung im Juli 2021 wurden die demokratischen Institutionen systematisch abgebaut und das Land in Richtung Autokratie gelenkt, während die Repressionen gegen Journalisten, politische Gegner und Aktivisten der Zivilgesellschaft zunahmen.
Wirtschaftlich kämpft Tunesien unter der Last der Auslandsschulden und den strengen Auflagen des IWF, was die makroökonomische Stabilität des Landes untergräbt. Die Inflationsrate liegt bei 8,3 % und die Arbeitslosigkeit bei hartnäckigen 15 %. Darüber hinaus hat sich Tunesien zu einem zentralen Knotenpunkt der Mittelmeer-Migrationsroute entwickelt, insbesondere nachdem sich die Migrationsmuster nach 2017 aufgrund des harten Durchgreifens in Libyen geändert haben. Das Land dient nun nicht nur tunesischen Staatsangehörigen, sondern zunehmend auch afrikanischen Migranten aus Ländern südlich der Sahara als primärer Ausgangspunkt nach Europa.
Im Juli 2023 hat die EU ein Abkommen zur Migrationssteuerung mit Tunesien geschlossen. Unter der Federführung führender EU-Politiker wurde Tunesien in diesem Abkommen Hilfe in Höhe von bis zu 1 Mrd. EUR zugesagt, die von verschiedenen Reformen und der Zusammenarbeit bei der Grenzverwaltung abhängig gemacht wurde. Ein entscheidender Betrag von 105 Millionen Euro wurde speziell für die Verbesserung der tunesischen Grenzkontrollkapazitäten bereitgestellt, um den Grenzübertritt von Migranten nach Europa zu verhindern. Doch trotz der Vereinbarung haben die Ausreisen aus Tunesien nach Europa weiterhin zugenommen stetig.
Das Abkommen wurde von der Zivilgesellschaft aus verschiedenen Gründen ausgiebig kritisiert . Zum einen fiel sie mit der zunehmenden Repression in Tunesien selbst zusammen, wo die Regierung verschiedener Menschenrechtsverletzungen, auch gegen Migranten, beschuldigt wurde. Die Konzentration der EU auf Grenzkontrollen wurde als Mitschuld an diesen Verstößen angesehen, da erhebliche EU-Mittel an Sicherheitskräfte geflossen sind, die in diese Verstöße verwickelt waren. Dies hat wiederum Zweifel an der Einhaltung von Menschenrechtsstandards in der EU aufkommen lassen.
Die EU hat sich auf die Einhaltung von Menschenrechtsstandards verpflichtet.Die Beziehungen haben sich weiter verschlechtert, nachdem Tunesien EU-Gelder zurückgegeben hat, während die Spannungen zwischen Brüssel und Tunis wegen des umstrittenen Migrantenabkommens eskalierten. Die Kommission bestätigte dass Tunesien 60 Millionen Euro im September 2023 zurückgegeben hat. Dies war ein schwerer Schlag für das von der Europäischen Kommission im Juli mit Tunesien unterzeichnete Migrantenabkommen, das Bargeld als Gegenleistung für die Unterstützung bei der Eindämmung der Migrantenströme über das Mittelmeer nach Europa vorsah. Die EU plant, den tunesischen Sicherheitskräften über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu 164,5 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Da ein erheblicher Teil davon für die Sicherheit und den Grenzschutz bereitgestellt wird, bleiben die Auswirkungen auf die Menschenrechte kritisch.
Während sich das Engagement der EU gegenüber Tunesien auf die Migration konzentriert, erweitert sich der Fokus auch auf die Diversifizierung der Energieversorgung
, insbesondere im Rahmen der Strategie .europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en“ target=“_blank“ rel=“noreferrer noopener“>REPowerEU -Initiative, um von der Abhängigkeit von russischem Gas und anderen fossilen Brennstoffen zu nachhaltigen Energiequellen wie Wasserstoff überzugehen. Tunesien positioniert sich als ein entscheidender Partner bei diesem Wandel und plant, bereits 2030 mit dem Export von erneuerbarem Wasserstoff über Pipelines nach Europa zu beginnen. Das Land will bis 2050 jährlich 6 Millionen Tonnen liefern und damit neben Marokko, Algerien und Ägypten zu den potenziellen Hauptlieferanten von Wasserstoff in die EU gehören.Diese ehrgeizigen Pläne haben jedoch eine heftige Kontroverse ausgelöst. Kritiker, insbesondere von Corporate Europe Observatory, haben die Strategie als „neokolonialen Ressourcenraub“ bezeichnet. Sie stellen in Frage, ob es angemessen ist, die begrenzten erneuerbaren Ressourcen Nordafrikas vorwiegend zum Nutzen Europas zu nutzen. Auch die Durchführbarkeit der Wasserstoffproduktion zur Erreichung dieser Ziele steht auf dem Prüfstand. Es wurden Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten und der geringen Energieeffizienz der Wasserstoffproduktion für den Export geäußert, wodurch wesentliche lokale Umweltbedürfnisse vernachlässigt und die regionale Nachhaltigkeitsagenda untergraben werden könnte.
Libanon
Libanon steht aufgrund mehrerer Krisen unter enormem Druck. Der seit 2011 andauernde Krieg im benachbarten Syrien hat rund 1,5 Millionen Flüchtlinge in den Libanon getrieben; bei einer Gesamtbevölkerung von 6 Millionen hat das Land damit die höchste Flüchtlingsrate pro Kopf weltweit. Diese Situation wurde verschärft durch eine verheerende Wirtschaftskrise, die 2019 begann und durch die COVID-19-Pandemie verschärft wurde, die etwa 80% der libanesischen Bevölkerung in die Armut stürzte, wobei 36 % unter der Grenze zur extremen Armut leben.
Die Krise verschärfte sich am 4. August 2020 mit der Explosion im Hafen von Beirut, die 218 Menschen tötete und umfassende materielle Schäden verursachte, die auf bis zu 4,6 Milliarden Dollar geschätzt werden. Von der Katastrophe waren mehr als die Hälfte der Gesundheitszentren der Hauptstadt und 56 % der Unternehmen betroffen.
Libanons Regierungsführung wird von Korruption und Ineffizienz geplagt und rangiert auf dem Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 149 von 180. Das politische System des Landes, das auf der Teilung der Macht zwischen verschiedenen sektiererischen Gruppen beruht, hat nicht effektiv funktioniert, da seit mehr als einem Jahrzehnt kein Haushalt mehr verabschiedet wurde und häufig der Vorwurf des Stimmenkaufs und der Wahlbeeinflussung erhoben wurde. Aufgrund des anhaltenden politischen Stillstands hat der Libanon seit Ende 2022 keinen Präsidenten mehr, und das Land wird derzeit von einer geschäftsführenden Regierung mit begrenzten Befugnissen geführt.
Die Flüchtlingsbevölkerung im Libanon befindet sich in einer katastrophalen humanitären Lage. Die Flüchtlinge, darunter etwa 815.000 bei den Vereinten Nationen registrierte Personen, kämpfen mit harten Lebensbedingungen, die durch unzureichende Unterkünfte, eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung und grassierende Ernährungsunsicherheit gekennzeichnet sind. Überwältigt von wirtschaftlichen und politischen Krisen, hat die libanesische Regierung die Registrierung neuer Flüchtlinge im Jahr 2015 angehalten was die Unterstützungsbemühungen erschwert.
Es wird jedoch erwartet, dass die Zahlen weiter steigen werden, da mehr Asylsuchende aus Palästina und anderen Kriegen in der Region ankommen. Nach Angaben von Human Rights Watch haben „jüngste Entscheidungen vieler EU-Mitgliedstaaten, die Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) auszusetzen, das 250.000 Palästinenser im Libanon unterstützt, von denen 80 % bereits unter der Armutsgrenze leben, haben die Flüchtlingsbevölkerung des Libanon noch mehr belastet.‘ Der Libanon erhielt im vergangenen Jahr nur 27 % der erforderlichen globalen Finanzmittel für seine Reaktion auf die syrischen Flüchtlinge, was sich erheblich auf die Fähigkeit auswirkt, die Grundversorgung dieser vertriebenen Bevölkerungsgruppen aufrechtzuerhalten.
Als Reaktion auf diese Krisen hat die EU Anfang Mai 2024 ein Abkommen geschlossen dem Libanon über drei Jahre hinweg 1 Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen. Ziel dieser Hilfe ist es, die libanesische Wirtschaft zu stabilisieren und die steigende Zahl der Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa einzudämmen. Dieses Abkommen hat jedoch Bedenken hinsichtlich des EU-Ansatzes zur Migrationssteuerung geweckt, der häufig der Grenzkontrolle Vorrang vor dem Schutz der Menschenrechte einräumt.
Menschenrechtsorganisationen haben Alarm geschlagen über die Behandlung von Syrern, die zwangsweise in ihr Heimatland zurückgeführt werden. Berichte von Amnesty International, Human Rights Watch und der Syrian Network for Human Rights schildern detailliert die systematischen Übergriffe durch syrische Sicherheitskräfte und regierungsnahe Milizen. Dazu gehören willkürliche Verhaftungen, Folter, Verschwindenlassen und außergerichtliche Tötungen, die sich häufig gegen Personen richten, denen Verbindungen zu Oppositionsgruppen nachgesagt werden, nur weil sie im Ausland Zuflucht gesucht haben – ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz des Non-Refoulement, ein Eckpfeiler des internationalen Rechts, der die Rückführung von Personen in Länder verbietet, in denen sie von serious threats to their life or freedom.
Union am Scheideweg
Die Europäische Union befindet sich heute an einem außenpolitischen Scheideweg. Die Partnerschaften der EU mit Nicht-EU-Ländern im Mittelmeerraum sind zwar komplex und vielfältig, werden aber nach wie vor von einer historisch bedingten neokolonialen Denkweise beeinflusst, die strategischen Interessen Vorrang vor fairen Partnerschaften einräumt. An diesem kritischen Punkt hat die EU die Qual der Wahl: Entweder sie setzt ihre derzeitige Taktik des einseitigen Handels und der Ressourcengewinnung fort oder sie wendet sich wirklich kooperativen Beziehungen zu, die die Souveränität und den wirtschaftlichen Fortschritt dieser Länder respektieren.
Im Bereich der Migration steht die EU vor einem ähnlichen Dilemma: Entweder sie hält an den Strategien zur Abschottung der Grenzen fest, die häufig die Menschenrechte gefährden, oder sie wählt einen ganzheitlicheren Ansatz, der die Ursachen von Migration und Vertreibung angeht. Dieser Moment bietet der EU die Gelegenheit, ihre Politik zu überdenken und neu auszurichten, um ihre selbsternannten Werte der Förderung von Frieden, Stabilität und Wohlstand besser zu wahren.
Doch das Potenzial eines rechteren Parlaments nach den Wahlen birgt ein erhebliches Risiko, diese ungerechten Praktiken zu vertiefen und das Erbe der Ausbeutung in modernem Gewand fortzuführen. Die jüngste Verabschiedung des EU-Migrationspaktes, der den Einsatz von Überwachungs- und Kontrolltechnologien fördert, deutet ebenfalls darauf hin, dass sich die Externalisierungspolitik verstärken wird, was zu einem moralisch kompromittierten und strategisch fehlerhaften Ansatz führt.



